Die Vorstellung von Bibliotheken hat sich in den letzten Jahrzehnten tiefgreifend gewandelt. Früher war eine Bibliothek ein Raum voller Regale, Ledersessel und flüsternder Besucher; heute ist sie oft nur noch einen Klick entfernt — ein universelles Gateway zu Milliarden von Seiten, Bildern, Tonaufnahmen und Videos. Digitale Bibliotheken sind nicht nur technische Plattformen, sie sind kulturelle und gesellschaftliche Institutionen, die Wissen demokratisieren, Forschung beschleunigen und Bildung für Menschen überall auf dem Planeten zugänglich machen. In diesem einleitenden Abschnitt möchte ich Ihnen ein Bild zeichnen: Stellen Sie sich vor, Sie sitzen nachts in einem kleinen Dorf, weit weg von einer Universitätsbibliothek, und haben dennoch Zugang zu Handschriften aus dem 12. Jahrhundert, wissenschaftlichen Artikeln, historischen Karten und Kinderbüchern in Ihrer Muttersprache. Das ist die Realität, die digitale Bibliotheken möglich machen — und sie ist voller Chancen, aber auch mit Herausforderungen versehen.
Digitale Bibliotheken sind dabei viel mehr als bloße Sammlungen digitalisierter Bücher. Sie verbinden Metadaten, Volltextsuche, Nutzerkonten, Lizenzmodelle und Schnittstellen für andere Anwendungen. Hinter der scheinbar einfachen Sucheingabe steckt ein komplexes Geflecht aus Standards, rechtlichen Rahmenbedingungen, technischen Lösungen und menschlichen Entscheidungen darüber, was digitalisiert und wie es präsentiert wird. Gleichzeitig bergen sie die Kraft, Marginalisiertes sichtbar zu machen, lokale Kulturen global zugänglich zu machen und wissenschaftliche Erkenntnisse zu beschleunigen. Doch um diese Kraft verantwortungsvoll zu nutzen, müssen wir nicht nur die Technologie, sondern auch Politik, Finanzierung und Ethik verstehen. In den folgenden Abschnitten werden wir diesen komplexen Kosmos von allen Seiten beleuchten — praxisnah, verständlich und mit einem Blick auf die Zukunft.
Was ist eine digitale Bibliothek wirklich?
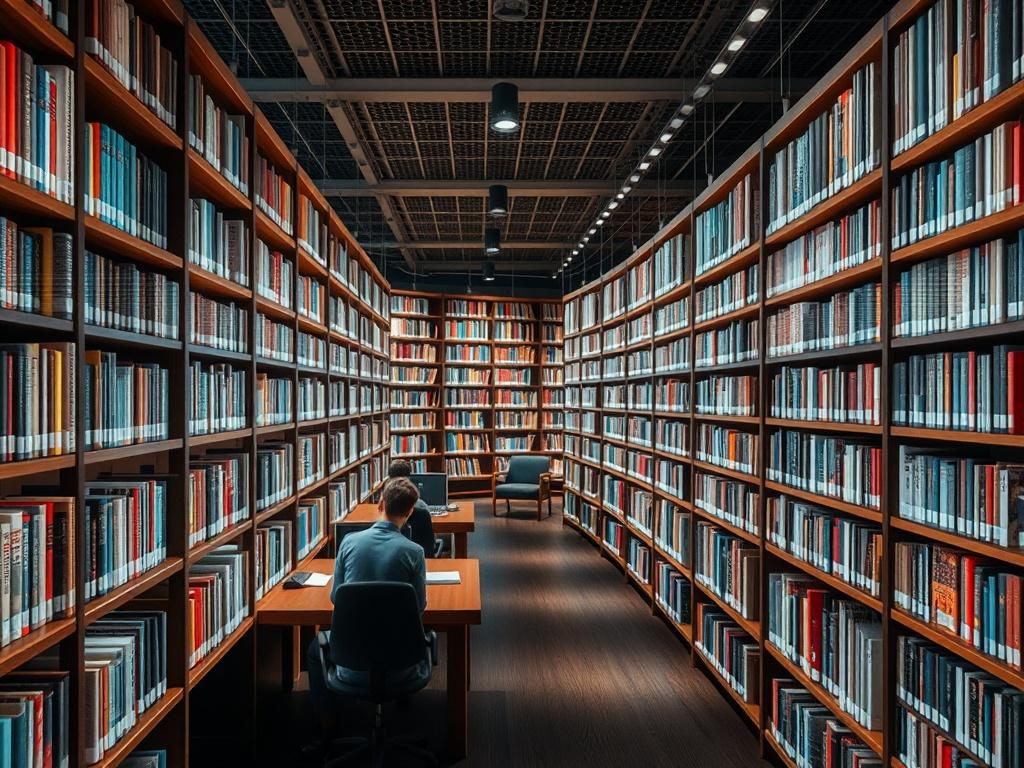
Eine digitale Bibliothek ist mehr als eine Online-Sammlung digitalisierter Bücher. Sie ist eine organisierte, durchsuchbare und oft kuratierte Sammlung digitaler Ressourcen, die über Webschnittstellen zugänglich ist. Dazu gehören gescannte Bücher und Zeitschriften, Fotografien, Ton- und Filmaufnahmen, Karten, Handschriften, Forschungsdaten und mehr. Digitale Bibliotheken können von Universitäten, öffentlichen Bibliotheken, nationalen Institutionen oder privaten Initiativen betrieben werden. Jede hat ihre eigenen Ziele, Prioritäten und Zielgruppen.
Die Technik hinter einer digitalen Bibliothek umfasst Scanner, Metadatenmodelle, Volltextdatenbanken, OCR-Software zur Texterkennung, digitale Langzeitarchivierung und Schnittstellen für die Integration in andere Systeme. Zugleich sind digitale Bibliotheken soziale Konstrukte: Entscheidungen darüber, welche Werke digitalisiert werden, welche Metadaten verwendet werden und wie Nutzungsrechte geregelt sind, haben tiefgreifende kulturelle Auswirkungen. Niemand kann neutral sein, wenn es darum geht, was aus dem kulturellen Gedächtnis digitalisiert und sichtbar gemacht wird.
Arten digitaler Bibliotheken
Digitale Bibliotheken lassen sich in verschiedene Typen einteilen: nationale Bibliotheken (z. B. die Deutsche Digitale Bibliothek), fachspezifische Repositorien (z. B. PubMed Central), Projektbibliotheken (z. B. Project Gutenberg), regionale Portale und kommerzielle Plattformen. Jede dieser Formen hat eigene Stärken: Nationale Bibliotheken haben oft umfassende Sammlungen und gesetzliche Verantwortung, während Projektbibliotheken schnell, offen und gemeinschaftsorientiert arbeiten.
Eine weitere wichtige Unterteilung ist die Frage der Zugänglichkeit: Open-Access-Repositorien stellen wissenschaftliche Artikel frei zur Verfügung, während kommerzielle Datenbanken hinter Paywalls liegen. Manche Bibliotheken kombinieren beides — sie digitalisieren historische Materialien, die gemeinfrei sind, und bieten gleichzeitig lizenzierte Inhalte für registrierte Nutzer an. Diese Mischformen sind oft pragmatisch, aber auch verwirrend für Nutzer, die wissen möchten, was sie frei nutzen dürfen.
Geschichte und Entwicklung: Vom Mikrofilm zur globalen Datenwolke
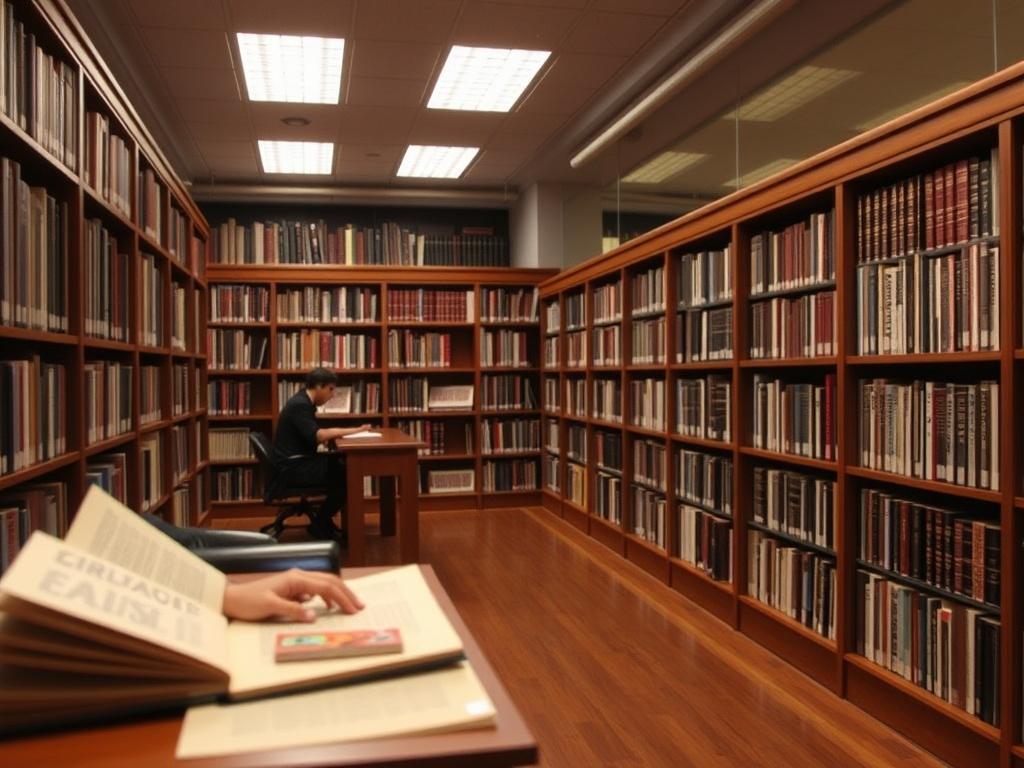
Die Idee, Wissen zu konservieren und zugänglich zu machen, ist uralt. Die Digitalisierung der Bibliotheken begann jedoch erst im 20. Jahrhundert mit der Einführung des Mikrofilms. Bibliotheken nutzten Mikrofilm, um Platz zu sparen und seltene Werke zu konservieren. Mit dem Aufkommen des Internets und leistungsfähiger Scanner in den 1990er Jahren beschleunigte sich die Entwicklung dramatisch. Initiativen wie Project Gutenberg legten früh den Grundstein für freie digitale Literatur, während große Projekte wie Google Books das Potenzial und gleichzeitig die Konflikte zwischen öffentlichem Interesse und Verlagsrechten offenbarten.
In den 2000er-Jahren entstand ein vielfältiges Ökosystem aus nationalen Digitalisierungsprogrammen, Universitätsrepositorien und Kulturportalen. Standardisierung, Metadatenformate wie MARC, Dublin Core und später Linked Data haben die Interoperabilität gefördert. Zugleich wurde die Frage der Langzeitarchivierung dringlicher: Digitale Formate altern, Server versagen, Rechte ändern sich — all das erfordert aktive Pflege, nicht nur einmalige Digitalisierung.
Wichtige Meilensteine
1) Project Gutenberg (1971): Frühe Open-Access-Initiative für gemeinfreie Werke.
2) Google Books-Projekt (ab 2004): Massen-Digitalisierung von Büchern und anschließende Rechtsstreitigkeiten.
3) Europeana (2008): Europäisches Portal für kulturelles Erbe, das Sammlungen aus Museen, Bibliotheken und Archiven zusammenführt.
4) HathiTrust (2008): Kooperative digitale Bibliothek nordamerikanischer Universitäten mit umfangreicher Forschungskompatibilität.
5) Nationale Digitalisierungsprogramme: Förderprogramme zur Digitalisierung von Beständen und zur Schaffung von Infrastrukturen.
Diese Meilensteine zeigen, wie technologische Machbarkeit, rechtliche Rahmenbedingungen und institutionelles Engagement zusammentreffen, um digitale Bibliotheken zu formen.
Technologie und Standards: Das Rückgrat digitaler Bibliotheken
Die Technik macht digitale Bibliotheken möglich — doch ohne Standards würden sie zu insularen Insellösungen verkommen. Wesentliche Komponenten sind Scanner, OCR (Optical Character Recognition), Metadatenstandards, Such-Engines, APIs und Langzeitarchivierungslösungen. Nur durch standardisierte Metadaten können verschiedene Bibliotheken ihre Bestände miteinander vernetzen. Formate wie Dublin Core, MARC21, METS und MODS sind weit verbreitet. Jüngere Ansätze setzen auf Linked Data und RDF, um semantische Verbindungen zwischen Ressourcen herzustellen.
OCR hat die Revolution erst möglich gemacht: Sie verwandelt Bilddateien in durchsuchbaren Text. Doch OCR ist fehleranfällig, besonders bei historischen Schriften oder seltenen Typografien. Deshalb sind Nachbearbeitung, Crowdsourcing-Korrekturen und Machine-Learning-gestützte Textverbesserungen wichtige Bereiche für Forschung und Entwicklung.
Interoperabilität und APIs
Damit Nutzer nicht jede Bibliothek einzeln durchsuchen müssen, sind Schnittstellen entscheidend. APIs (Application Programming Interfaces) erlauben das maschinelle Abfragen von Metadaten, das Einbinden von Sammlungen in Drittanwendungen und die Entwicklung neuer Dienste. Protokolle wie OAI-PMH (Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting) haben es ermöglicht, Metadaten automatisch von vielen Institutionen zusammenzutragen. Moderne Ansätze gehen jedoch darüber hinaus und nutzen RESTful APIs, JSON-LD und Linked Data für semantische Durchsuchbarkeit.
Interoperabilität erleichtert auch Forschung: Wissenschaftler können Datensätze herunterladen, Korrelationsstudien durchführen und große Textmengen analysieren. Hier entsteht ein neuer Forschungsbereich — die digitale Geisteswissenschaft (Digital Humanities) — der traditionelle Geistesfächer mit datenwissenschaftlichen Methoden verbindet.
Nutzen und gesellschaftliche Auswirkungen
Digitale Bibliotheken transformieren Bildung, Forschung und Kultur. Studierende in abgelegenen Regionen erhalten Zugang zu Lehrmaterialien; Forschende können historische Zeitreihen computergestützt analysieren; Kulturerbe-Institutionen vermitteln ihre Sammlungen international. Der Zugang zu Wissen ist nicht mehr an physische Präsenz gebunden — das hat demokratische Effekte: Informationsgerechtigkeit wird verbessert, Bildungsbarrieren sinken, und marginalisierte Stimmen können leichter Gehör finden.
Ein weiterer positiver Effekt ist die Bewahrung. Fragile Handschriften oder seltene Bücher, die sich nicht oft der Öffentlichkeit zeigen lassen, können digitalisiert werden, sodass Inhalte über Jahre verfügbar bleiben, auch wenn das Original weiter geschützt werden muss. Digitale Kopien ermöglichen zudem neue Formen der Forschung, etwa durch Text-Mining historischer Dokumente oder 3D-Scans von Kunstgegenständen, die detailreiche Analyse erlauben.
Wirtschaftliche und kulturelle Effekte
Ökonomisch gesehen reduzieren digitale Bibliotheken Kosten für physische Lagerung und erleichtern die Distribution. Kulturwirtschaft profitiert, weil digitalisierte Inhalte in Bildungsprodukten, Ausstellungen und künstlerischen Projekten nutzbar werden. Gleichzeitig eröffnen sich neue Geschäftsmodelle: Lizenzierung von Bildmaterial, digitale Leihsysteme, Mikrozahlungen für einzelne Nutzungen oder Abonnements.
Doch es gibt auch subtile kulturelle Effekte: Mit der Sichtbarkeit von Sammlungen verändern sich Nachfrage und Forschungsschwerpunkte. Werke, die digital leicht entdeckt werden, erhalten Aufmerksamkeit, was wiederum Bedeutung und Wertschätzung beeinflusst. Diese Rückkopplung kann positiv sein, aber auch dazu führen, dass weniger digitalisierte Sprachen oder Kulturen weiter marginalisiert bleiben.
Herausforderungen: Rechtliche, technische und soziale Hürden
Digitale Bibliotheken sind kein Selbstläufer. Sie stehen vor einer Reihe komplexer Herausforderungen. Rechtlich ist die Lage oft kompliziert: Urheberrecht schränkt die Digitalisierung und Zugänglichmachung ein. Während gemeinfreie Werke frei digitalisiert werden können, bedürfen viele moderne Werke einer Lizenz oder Genehmigung der Rechteinhaber. Verschiedene Rechtsräume (z. B. EU, USA, Kanada) haben unterschiedliche Auslegungen des Urheberrechts, was internationale Kooperationen erschwert.
Technisch sind Langzeitarchivierung, Formatverfall und Datenintegrität zentrale Probleme. Digitale Dateien benötigen kontinuierliche Pflege: Migration auf neue Formate, Sicherung vor Datenverlust und Schutz gegen Cyberangriffe. Zudem sind ältere Dokumente, Handschriften und schlecht gedruckte Materialien schwierig zu digitalisieren und durch OCR korrekt zu erschließen.
Soziale Herausforderungen betreffen digitale Ungleichheit: Wer keinen Internetzugang oder digitale Endgeräte hat, profitiert nicht von digitalen Bibliotheken. Sprachbarrieren dürfen nicht unterschätzt werden: Viele digitale Sammlungen sind in wenigen dominanten Sprachen verfügbar, während eine Vielzahl von Sprachen unterrepräsentiert bleibt. Schließlich gibt es Fragen der kulturellen Sensibilität: Manche Gemeinschaften möchten bestimmte Inhalte nicht öffentlich zugänglich sehen, etwa religiöse Texte oder rituelle Objekte.
Praktische Probleme bei der Digitalisierung
1) Physischer Zustand der Bestände: Zerbrechliche Bücher erfordern spezielle Scantechniken und konservatorische Maßnahmen.
2) Komplexe Rechteklärung: Für jedes Werk müssen ggf. Rechteinhaber ermittelt und kontaktiert werden.
3) Qualitätskontrolle: OCR-Fehler und falsche Metadaten verringern die Nutzbarkeit.
4) Finanzierung: Digitalisierung ist teuer — von Personal über Technik bis zu Langzeitkosten.
5) Nutzerakzeptanz: Nutzer müssen sich an neue Interfaces gewöhnen; Barrierefreiheit ist oft unzureichend.
Diese praktischen Probleme zeigen: Digitalisierung ist nicht nur ein technisches Projekt, sondern ein langfristiges institutionelles Engagement.
Gute Praxisbeispiele: Inspirationen aus aller Welt
Ein Blick auf erfolgreiche Projekte zeigt praktische Lösungswege. Project Gutenberg ist ein Paradebeispiel für Crowdsourcing und Freiwilligenarbeit, während HathiTrust und Europeana den Wert von Kooperation und gemeinsamen Standards demonstrieren. Die Deutsche Digitale Bibliothek bündelt nationale Sammlungen und zeigt, wie kulturelles Erbe gebündelt präsentiert werden kann. Auf regionaler Ebene sind viele Universitätsrepositorien und lokale digitale Archive spannende Beispiele für die Verbindung von Forschung, Lehre und öffentlichem Zugang.
In Entwicklungsländern entstehen oft kreative, lokale Lösungen: Community-basierte Scanning-Programme, mobile Bibliotheksapps und Bündelung lokaler Sprachen. Diese Initiativen sind besonders wichtig, weil sie kulturelle Vielfalt schützen und lokalen Zugang stärken.
Kurzportraits ausgewählter Projekte
| # | Projekt | Schwerpunkt | Besonderheit |
|---|---|---|---|
| 1 | Project Gutenberg | Gemeinfreie Literatur | Freiwilligengetrieben, frühe Open-Access-Bewegung |
| 2 | Europeana | Europäisches Kulturerbe | Vernetzung von Museen, Bibliotheken und Archiven |
| 3 | HathiTrust | Wissenschaftliche Sammlungen | Kooperative Langzeitarchivierung nordamerikanischer Universitäten |
| 4 | Deutsche Digitale Bibliothek | Nationales Kulturerbe | Integration nationaler Sammlungen und Metadaten |
| 5 | Digital Public Library of America (DPLA) | US-amerikanisches Kultur- und Bildungsangebot | Aggregiert Metadaten von hunderten Institutionen |
Wie Nutzer digitale Bibliotheken effektiv nutzen – ein praktischer Leitfaden
Digitale Bibliotheken bieten eine Vielzahl von Funktionen: einfache und erweiterte Suche, Filter nach Medientyp, Sammlungen und Urheberrechtshinweisen, Volltextzugriff, Download-Optionen, Annotationswerkzeuge und Exporte von Zitaten oder Metadaten. Um das Beste aus ihnen herauszuholen, lohnt sich ein strukturierter Ansatz.
Zunächst: Klarheit über das Ziel. Suchen Sie nach einer bestimmten Quelle, einer thematischen Sammlung oder wollen Sie breiter recherchieren? Nutzen Sie erweiterte Suchoptionen, um nach Datum, Sprache, Medientyp oder Urheber zu filtern. Speichern und dokumentieren Sie Treffer systematisch — viele Plattformen erlauben das Anlegen von Sammlungen oder das Exportieren von Zitaten. Für umfangreiche Forschungsarbeiten sind APIs und Bulk-Downloads interessant, sofern die Lizenz dies erlaubt.
10 Tipps für effektive Nutzung
- Definieren Sie Ihre Suchfragen präzise und nutzen Sie erweiterte Suchoperatoren.
- Verwenden Sie Filter für Jahr, Sprache, Format und Rechte, um irrelevante Treffer auszuschließen.
- Nutzen Sie Sammlungsfunktionen, um relevante Dokumente zu organisieren.
- Exportieren Sie Metadaten frühzeitig, um Quellen sauber zu dokumentieren.
- Prüfen Sie Lizenz- und Nutzungsbedingungen, bevor Sie Inhalte weiterverwenden.
- Nutzen Sie Annotations- und Notizfunktionen für spätere Referenz.
- Für große Textmengen: prüfen Sie, ob Bulk-Downloads oder APIs verfügbar sind.
- Bei OCR-Fehlern: vergleichen Sie Bild und Text und dokumentieren Sie Unstimmigkeiten.
- Nutzen Sie Tutorials und Hilfeangebote der Plattformen, um Tipps und Tricks zu lernen.
- Teilen Sie Fundstellen in Forschungsteams über Plattform-Tools oder externe Referenzmanager.
Beitragen und mitgestalten: So können Sie helfen
Digitale Bibliotheken leben von Beiträgen: Einreichungen von Institutionen, Freiwilligenarbeit zur Korrektur von OCR-Texten, Transkription historischer Dokumente oder die Freigabe eigener Werke unter offenen Lizenzen. Es gibt viele Wege, wie Einzelne und Gemeinschaften mitmachen können. Bibliotheken bieten oft Freiwilligenprogramme, Hackathons und Crowdsourcing-Projekte an. Für Forschende sind Open-Access-Publikationen und das Hochladen von Preprints sinnvolle Beiträge.
Auch finanziell können lokale Unterstützer und Stiftungen helfen, denn Digitalisierung ist teuer. Schließlich sind politische Entscheidungen nötig: Für nachhaltige digitale Infrastrukturen braucht es politische Unterstützung und langfristige Förderstrategien. Jede Form des Engagements stärkt das gemeinsame Wissenserbe.
Wie man mit kleinen Schritten beginnt
1) Freiwilligenarbeit bei Transkriptionsprojekten beitreten.
2) Eigene Forschungsergebnisse in institutionale Repositorien hochladen.
3) Lokale Archive unterstützen — z. B. durch Spenden oder Öffentlichkeitsarbeit.
4) Offene Lizenzen nutzen und anderen empfehlen.
5) Sich in Communitys und Foren austauschen, um Best Practices zu verbreiten.
Diese Schritte sind oft niedrigschwellig, machen aber einen spürbaren Unterschied.
Zukunftstrends: KI, Linked Data und globale Zusammenarbeit
Die Zukunft digitaler Bibliotheken ist eng mit technologischen und gesellschaftlichen Entwicklungen verknüpft. Künstliche Intelligenz (KI) eröffnet neue Möglichkeiten: bessere OCR-Ergebnisse, automatisierte Metadatengenerierung, semantische Suche und personalisierte Empfehlungen. KI kann helfen, große Sammlungen zu kategorisieren, Entitäten zu erkennen (Personen, Orte, Ereignisse) und Verbindungen zwischen verstreuten Ressourcen sichtbar zu machen.
Linked Data und semantische Web-Technologien ermöglichen die Verknüpfung von Objekten über Institutionen hinweg. Stellen Sie sich vor, Sie suchen eine historische Figur und erhalten automatisch eine Karte, Zeitstrahl, Publikationsliste und Vernetzung zu Archivmaterialien — das ist die Vision vernetzter Daten. Globale Zusammenarbeit wird dabei entscheidend sein: Standards, rechtliche Vereinbarungen und gemeinsame Infrastrukturen müssen international koordiniert werden.
Potentielle Risiken neuer Technologien
Bei aller Euphorie sind Risiken zu beachten: KI kann Daten verzerren, wenn Trainingsdaten einseitig sind. Automatische Klassifikationen können kulturelle Nuancen übersehen. Außerdem besteht die Gefahr, dass kommerzielle Akteure die Infrastruktur dominieren, wenn nicht öffentlich finanzierte Alternativen gestärkt werden. Datenschutz und ethische Fragen (z. B. bei personenbezogenen historischen Daten) bleiben zentral.
Politik, Finanzierung und Nachhaltigkeit
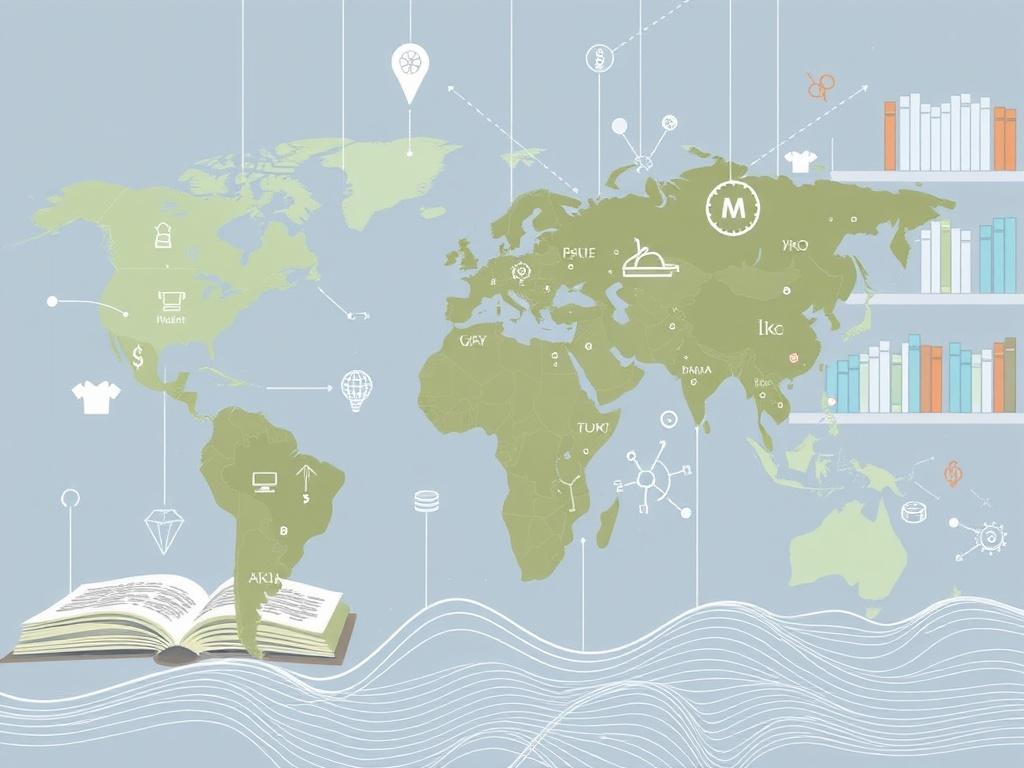
Digitale Bibliotheken benötigen stabile Finanzierungsmodelle. Kurzfristige Projektförderungen sind wertvoll, reichen aber nicht für langfristige Pflege. Nachhaltigkeit bedeutet sowohl technische Maßnahmen (Redundanz, Migration, offene Formate) als auch institutionelle Strategien (Langzeit-Budgets, Partnerschaften). Öffentliche Investitionen sind notwendig, um kulturelles Erbe als Gemeingut zu erhalten.
Politisch braucht es klare Urheberrechtsregelungen, die Digitalisierung ermöglichen, ohne die Rechte von Urhebern zu unterminieren. Modelle wie Orphan Works-Lösungen, erweiterte Schrankenregelungen für Bildung und Forschung sowie fair gestaltete Lizenzverträge können helfen. In der EU und anderswo werden diese Fragen intensiv diskutiert — die Entscheidungen werden enorme Auswirkungen auf zukünftige Zugänglichkeit haben.
Finanzierungsmodelle im Überblick
| # | Modell | Vor- und Nachteile |
|---|---|---|
| 1 | Öffentliche Finanzierung | Stabil, gemeinwohlorientiert; abhängig von Haushaltsentscheidungen |
| 2 | Partnerschaften (Universitäten, Stiftungen) | Flexibel, innovationsfreundlich; kann befristet sein |
| 3 | Kommerzielle Lizenzierung | Einnahmequelle; Risiko der Zugangsbeschränkung |
| 4 | Crowdfunding und Spenden | Engagierte Community-Unterstützung; unsichere Mittel |
Messung von Erfolg: Metriken und Bewertung
Wie misst man den Erfolg einer digitalen Bibliothek? Quantitative Metriken wie Seitenaufrufe, Downloads und Nutzerzahlen geben Hinweise, sagen aber wenig über gesellschaftlichen Wert. Qualitative Bewertungen, Nutzerzufriedenheit, wissenschaftliche Zitationen und Bildungswirkung sind ebenso wichtig. Evaluationen sollten auch die Vielfalt der Nutzer, die geografische Reichweite und die Integration in Bildungsprozesse berücksichtigen.
Langfristig sind Indikatoren wie die Nachhaltigkeit der digitalen Infrastruktur, die Aktualität der Metadaten und die Stabilität rechtlicher Zugangsbedingungen entscheidend. Erfolgreiche Projekte kombinieren kurzfristige Nutzungsmetriken mit langfristigen Impact-Studien.
Empfohlene Kennzahlen
- Unique Visitors und Downloadzahlen (Kurzfristig)
- Engagement-Rate (Verweildauer, Interaktionen)
- Akademische Zitationen und Verweise
- Integration in Bildungsprogramme (Lehrpläne, MOOCs)
- Geografische und sozioökonomische Reichweite
- Technische Gesundheit (Backup, Formatmigrationen)
Praktische Empfehlungen für Entscheidungsträger
Für Bibliotheksleiter, Politiker und Förderer hier einige konkrete Empfehlungen: Fördern Sie offene Standards und Interoperabilität; investieren Sie in Langzeitarchivierung; unterstützen Sie Open Access; stellen Sie klare Regeln zur Rechteklärung bereit; bauen Sie nutzerfreundliche Interfaces und barrierefreie Angebote auf; und fördern Sie die Einbindung von Communities, um kulturelle Sensibilität zu gewährleisten. Kooperation ist zentral: Kein Akteur kann allein die digitale Transformation stemmen.
Gleichzeitig sollten Förderprogramme längerfristig angelegt werden und nicht nur kurzfristige Projekte finanzieren. Bildungsinitiativen, um digitale Kompetenzen zu stärken, sind ebenfalls wichtig, damit Nutzer die Angebote effektiv nutzen können.
Schlussfolgerung
Digitale Bibliotheken sind viel mehr als digitale Kopien alter Bücher. Sie sind lebendige, komplexe Ökosysteme, die Technologie, Recht, Kultur und Politik vereinen. Sie bieten enorme Chancen für Bildung, Forschung und kulturelle Teilhabe, stellen uns aber auch vor schwierige Fragen: Wie sichern wir langfristig Zugang? Wie schützen wir Vielfalt und Sensibilität? Wie finanzieren wir nachhaltige Infrastrukturen? Die Antworten erfordern Zusammenarbeit über Institutionen und Ländergrenzen hinweg — und Engagement auf individueller Ebene. Wenn wir die richtigen Entscheidungen treffen, können digitale Bibliotheken eine inklusive Wissensgesellschaft fördern, in der Wissen nicht nur gespeichert, sondern geteilt, erforscht und lebendig gehalten wird.