Die Wolke klingt leicht, fast poetisch: Daten schweben scheinbar schwerelos, E-Mails kommen an, Fotos werden synchronisiert, und ganze Unternehmen laufen rund um die Uhr auf scheinbar magischen Serverwolken. Doch wie oft haben wir schon innegehalten und gefragt: Was steckt eigentlich hinter dieser Wolke? Welche Ressourcen werden verbraucht, welche Emissionen entstehen, und wie nachhaltig ist dieses System, von dem unser digitales Leben abhängt? In diesem umfangreichen Text nehme ich Sie mit auf eine Reise durch Rechenzentren, Stromnetze, Kühlanlagen und Virtualisierungsebenen. Wir schauen uns an, wo die größten Umweltkosten liegen, wie Cloud-Anbieter reagieren — und vor allem, was wir als Nutzerinnen und Nutzer und als Unternehmen tun können, um die Cloud grüner zu machen.
Die Idee der digitalen Nachhaltigkeit ist nicht neu, aber sie gewinnt an Dringlichkeit: Während digitale Dienste wachsen, steigt auch der Energieverbrauch. Gleichzeitig verändert sich die Art der Stromerzeugung, neue technische Lösungen entstehen, und gesetzliche sowie gesellschaftliche Erwartungen an Transparenz und Verantwortung nehmen zu. Dieser Artikel erklärt die Zusammenhänge verständlich, beleuchtet kritische Punkte frank und frei und gibt praktische Handlungsoptionen — wissenschaftlich fundiert, aber in einem erzählerischen Stil, der das Thema greifbar macht.
Warum digitale Nachhaltigkeit zählt

Die Digitalisierung durchdringt alle Lebensbereiche: Bildung, Arbeit, Gesundheitswesen, Verwaltung und Unterhaltung. Jede Interaktion hinterlässt einen Fußabdruck — nicht sichtbar wie eine Papierrechnung, aber real messbar in Kilowattstunden und Tonnen CO2. Digitale Nachhaltigkeit geht über lediglich „weniger Stromverbrauch“ hinaus. Es geht darum, wie wir Software entwerfen, Hardware nutzen, Infrastruktur betreiben und politische Rahmenbedingungen setzen, damit digitale Dienste langfristig tragfähig bleiben — ökologisch, ökonomisch und sozial.
Wenn Unternehmen ihre IT in die Cloud verlagern, können Effizienzen entstehen: geteilte Ressourcen, bessere Auslastung und Skaleneffekte. Gleichzeitig entstehen neue Risiken: Konzentration großer Rechenzentren an wenigen Standorten, Abhängigkeit von Stromnetzen und Rohstoffbedarf für Serverhardware. Darum ist es wichtig, die Balance zu finden zwischen den Vorteilen der Digitalisierung und dem Wunsch, den ökologischen Fußabdruck zu reduzieren. Es ist eine Frage von Design, Governance und Verhalten — und von klaren Messgrößen.
Was ist die Cloud wirklich?
Die „Cloud“ ist kein mysteriöser Ort. Hinter dem Wort verbergen sich physische Rechenzentren mit tausenden von Rechnern, Speichersystemen und Netzwerkinfrastrukturen. Diese Anlagen benötigen Energie, sowohl für den Betrieb der IT als auch für die Kühlung und Sicherheit. Außerdem werden Daten physisch auf Festplatten gespeichert und über Glasfaser- und Mobilnetze transportiert. Die Cloud ist also ein komplexes System aus Hardware, Software, Stromversorgung und Infrastruktur.
Viele Nutzerinnen und Nutzer sehen nur die Oberfläche: Apps, Speicherplatz und Dienste. Diese Abstraktion ist nützlich, kann aber dazu verleiten, die Umweltkosten zu unterschätzen. Bei einer fundierten Betrachtung müssen wir die gesamte Lieferkette betrachten: Herstellung der Hardware, Betrieb der Rechenzentren, Energieerzeugung, Transport und Entsorgung. Digitale Nachhaltigkeit bedeutet, diese Elemente in ihrer Gesamtheit zu bewerten und nicht nur isoliert einzelne Komponenten.
Typen von Cloud-Architekturen
Es gibt verschiedene Modelle: Public Cloud, Private Cloud und Hybrid Cloud. Public Clouds werden von großen Anbietern betrieben und bieten Multi-Tenant-Architekturen. Private Clouds sind dedizierte Umgebungen, oft in Firmenrechenzentren. Hybrid Clouds kombinieren beides. Jede Architektur hat Vor- und Nachteile in Bezug auf Energieeffizienz, Flexibilität und Kontrolle. Public Clouds nutzen oft Skalenvorteile, während Private Clouds mehr Kontrolle über Energiequellen erlauben.
Diese Auswahl beeinflusst die Nachhaltigkeit: Eine schlecht ausgelastete Private Cloud kann ineffizienter sein als eine gut gemanagte Public Cloud, die erneuerbare Energien nutzt. Umgekehrt bietet eine lokal betriebene Private Cloud die Möglichkeit, gezielt mit Ökostrom zu arbeiten, wenn die Infrastruktur und das Management stimmen.
Der Energiebedarf der Rechenzentren
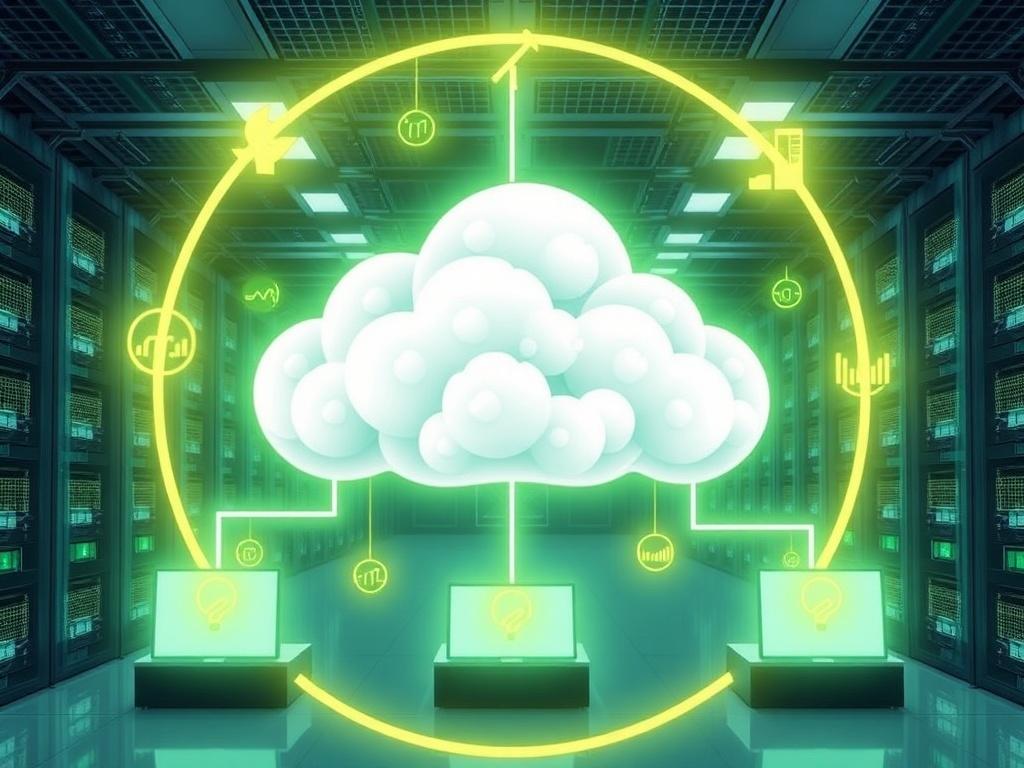
Rechenzentren verbrauchen Energie in mehreren Schichten: IT-Komponenten (Server, Speicher, Netzwerk), Unterstützungssysteme (Kühlung, USV, Beleuchtung) und Infrastrukturbetrieb (Sicherheits- und Verwaltungssysteme). Während Server die offensichtlichen Verbraucher sind, kostet das „Drumherum“ oft ähnlich viel Energie — die Kühlung allein kann einen erheblicher Anteil am Gesamtverbrauch ausmachen, insbesondere in heißen Regionen.
Berichte großer Forschungsinstitute zeigen: Der Energiebedarf von Datenverarbeitung steigt weltweit, aber dank Effizienzsteigerungen relativ langsamer als das Datenvolumen. Dennoch bleibt die absolute Bandbreite hoch, und der Trend zu immer datenintensiveren Anwendungen (KI, Streaming, Blockchain) verstärkt die Herausforderung. Deshalb sind Investitionen in energieeffiziente Hardware, intelligente Kühlung und Optimierung der IT-Workloads so wichtig.
Kernfaktoren für den Stromverbrauch
Mehrere Faktoren bestimmen den Stromverbrauch eines Rechenzentrums: Serverauslastung, Art der Anwendungen (z. B. rechenintensive KI vs. einfache Web-Services), Energieeffizienz der Hardware, PUE-Wert (Power Usage Effectiveness) und die Effizienz der Netzversorgung. Eine schlecht ausgelastete Infrastruktur verschwendet Energie; eine zu starre Architektur verhindert die dynamische Anpassung an Nachfrage. Die Herausforderung ist also sowohl technisch als auch organisatorisch.
CO2-Fußabdruck und graue Energie
Der CO2-Fußabdruck eines Cloud-Dienstes umfasst nicht nur den Betrieb, sondern auch die Herstellung der Hardware (Graue Energie), den Transport, die Wartung und schließlich die Entsorgung. Besonders die Produktion von Servern, Chips und Festplatten verursacht große Emissionen, da sie energieintensiv ist und oft in Regionen mit hohem CO2-Intensität der Energieversorgung stattfindet.
Wenn ein Rechenzentrum „CO2-neutral“ wirbt, muss man genau hinschauen: Wird nur der laufende Betrieb betrachtet oder die gesamte Lifecycle-Emission? Viele Anbieter kompensieren Emissionen durch Zertifikate oder kaufen erneuerbare Energie. Diese Maßnahmen sind wichtig, aber nicht immer ausreichend, da sie meist nur laufende Emissionen adressieren und nicht die graue Energie vollständig kompensieren. Eine echte Nachhaltigkeitsstrategie berücksichtigt beides: laufende Emissionen minimieren und den Lebenszyklus verbessern.
Tabelle 1: Typische Anteile an den Gesamt-CO2-Emissionen im Lebenszyklusbetrieb eines Rechenzentrums
| Komponente | Typischer Anteil (%) | Bemerkung |
|---|---|---|
| IT-Betrieb (Server, Storage, Netzwerk) | 40–60 | Direkter Stromverbrauch der IT-Hardware |
| Kühlung und Infrastruktur (PUE-bezogen) | 20–40 | Abhängig vom Standort und Kühltechnik |
| Herstellung (Graue Energie) | 10–30 | Fertigung von Hardware, Transport |
| Netzverluste und Distribution | 5–15 | Stromübertragung und Umwandlung |
Erneuerbare Energien und der Strommix
Ein zentraler Hebel für grünere Clouds ist der Einsatz erneuerbarer Energien. Anbieter investieren massiv in Wind- und Solarprojekte oder kaufen Strom aus regenerativen Quellen via Stromlieferverträge (PPAs). Das ist ein positiver Trend: Je höher der Anteil erneuerbarer Energien am Netz, desto geringer die CO2-Intensität des Betriebs. Allerdings bringt dies Herausforderungen mit sich: Erneuerbare sind teilweise volatil, und die zeitliche Übereinstimmung von Stromerzeugung und Verbrauch stimmt nicht immer.
Daher kombinieren Betreiber verschiedene Strategien: Energiespeicher, Load-Shifting (Verlagerung nicht zeitkritischer Berechnungen in Zeiten hoher regenerativer Produktion), Standortwahl in Regionen mit grünerem Strommix und direkte Investitionen in erneuerbare Projekte. Regulatorische Rahmenbedingungen und Marktmechanismen beeinflussen zudem, wie schnell und effizient diese Transformation erfolgt.
Grüner Strom ist nicht gleich grün
Wichtig ist die Unterscheidung zwischen „Strom aus erneuerbaren Quellen“ und tatsächlicher zusätzlicher Ökostromproduktion. Der Kauf von Zertifikaten kann zwar helfen, aber nur zusätzliche Investitionen in erneuerbare Anlagen führen zu echter Dekarbonisierung. Ferner ist die geografische Herkunft von Strom relevant: Ein Rechenzentrum in einer Region mit Kohlestrom hat eine andere Bilanz als eines, das in einer Region mit viel Wasserkraft liegt. Deshalb sind Transparenz und standardisierte Berichtsweisen essenziell.
Kühlung, Effizienz und der PUE-Wert
Der PUE-Wert (Power Usage Effectiveness) ist eine Kennzahl, die angibt, wie viel Gesamtenergie ein Rechenzentrum verbraucht im Verhältnis zur Energie, die tatsächlich IT-Equipment nutzt. Ein PUE von 1,2 ist exzellent, ein PUE von 2,0 eher schlecht. Durch Fortschritte in Designs, Außenluftkühlung (Free Cooling), immersiver Kühlung und Wärmerückgewinnung lassen sich erhebliche Einsparungen erzielen.
Interessant ist die Innovationsebene: Immersive Cooling, bei dem Server in Flüssigkeiten tauchen, kann die Effizienz drastisch verbessern und ermöglicht höhere Packungsdichten. Gleichzeitig bleibt die Herausforderung, diese Technologien skalierbar und kosteneffektiv zu implementieren. Betreiber investieren auch in Abwärmenutzung — etwa die Wärme von Rechenzentren zur Beheizung von Städten zu verwenden — ein Ansatz, der ökologische und ökonomische Vorteile verbindet.
Technische Maßnahmen zur Verbesserung der Kühlung
— Wärmerückgewinnungssysteme für lokale Nutzung
— Nutzung von Außenluft in kühlen Klimazonen
— Umstieg auf Flüssigkühlung für hohe Dichte-Workloads
— Verbesserte Luftstrom-Designs und modulare Rechenzentrumseinheiten
— Einsatz intelligenter Steuerungssysteme zur dynamischen Anpassung
Diese Maßnahmen sind nicht nur technischer Natur; sie benötigen auch organisatorische Veränderungen und teilweise neue Geschäftsmodelle, etwa Partnerschaften zwischen Rechenzentrumsbetreibern und Kommunen.
Softwareeffizienz, Virtualisierung und Verschwendung
Nicht nur Hardware entscheidet über die Nachhaltigkeit — Software spielt eine zentrale Rolle. Unoptimierte Anwendungen, überdimensionierte virtuelle Maschinen und ineffiziente Datenhaltung führen zu Ressourcenverschwendung. Ein kleines, aber weit verbreitetes Beispiel ist die „Always-on“-Konfiguration von Entwicklungs- und Testumgebungen, die 24/7 laufen, obwohl sie nur selten genutzt werden.
Virtualisierung und Containerisierung bieten Hebel: Durch bessere Auslastung und dynamisches Scaling können Ressourcen genau dann bereitgestellt werden, wenn sie gebraucht werden. Zugleich bringen neue Paradigmen wie Serverless Computing die Möglichkeit, noch feingranularer zu konsumieren — und damit potenziell Energie zu sparen. Allerdings steigt auch hier die Komplexität: Mehr Schichten bedeuten mehr Managementaufwand, und ohne Monitoring geht schnell Energie verloren.
Liste 1: Hauptstrategien zur Verbesserung der Softwareeffizienz
- Right-Sizing von VMs: Ressourcen bedarfsgerecht zuteilen
- Autoscaling: Dynamisches Hoch- und Runterskalieren
- Code-Optimierung: Effiziente Algorithmen und ressourcenschonende Architekturen
- Lifecycle-Management: Nicht genutzte Instanzen automatisch beenden
- Datenlebenszyklus: Archivierung und Löschung veralteter Daten
Diese Maßnahmen sind oft niedrig-hängende Früchte: Viele Unternehmen können sofort Energie und Kosten sparen, wenn sie ihre Cloud-Nutzung regelmäßig analysieren und optimieren.
Transparenz, Messung und Standards
Eine große Hürde in der Bewertung der Nachhaltigkeit von Cloud-Diensten ist das Fehlen einheitlicher Messstandards. Verschiedene Anbieter verwenden unterschiedliche Metriken, Reporting-Perioden und Annahmen. Das erschwert Vergleiche und vernebelt die tatsächliche Umweltauswirkung. Deshalb gewinnen Initiativen an Bedeutung, die einheitliche Rahmenwerke schaffen, etwa die Entwicklung standardisierter CO2-Rechenmethoden für digitale Dienstleistungen.
Genaues Monitoring ist essenziell: Nur wer misst, kann steuern. Modernes Metrik- und Monitoring-Tooling erlaubt es, Energie- und Emissionsdaten bis auf Service-Ebene aufzuschlüsseln. Unternehmen können so Klimabilanzen für einzelne Anwendungen erstellen und gezielt Verbesserungen planen. Auch gesetzliche Anforderungen an Scope-Emissions (Scope 1–3) treiben diese Transparenz voran.
Wichtige Kennzahlen
— PUE (Power Usage Effectiveness)
— CO2-Intensität des genutzten Stroms (gCO2/kWh)
— Auslastung der Server (CPU, RAM)
— Emissionen entlang des Life Cycle (Scope 1–3)
— Water Usage Effectiveness (WUE) in wasserkritischen Regionen
Je mehr Daten verfügbar sind, desto besser lassen sich Maßnahmen priorisieren. Transparente Anbieter veröffentlichen regelmäßig Datencenter-spezifische Metriken und zeigen Investitionen in erneuerbare Projekte offen auf.
Verantwortung von Anbietern und Nutzern
Die Verantwortung für digitale Nachhaltigkeit liegt nicht allein bei den Cloud-Anbietern, aber sie spielen eine Schlüsselrolle. Große Hyperscaler investieren massiv in Rechenzentrums-Design, erneuerbare Energien und Forschung. Gleichzeitig liegt ein großer Hebel bei den Nutzern: Unternehmen, die ihre IT-Architekturen optimieren, deaktivieren unnötige Dienste und wählen Anbieter nach ökologischen Kriterien, können die Nachfrage nach nachhaltigen Lösungen stärken.
Transparenz ist ein zweischneidiges Schwert: Anbieter sollten klare, verifizierbare Angaben machen, damit Kunden fundierte Entscheidungen treffen können. Regulatorische Anforderungen, wie Berichtspflichten über CO2-Emissionen, können diesen Prozess beschleunigen. Auch Zertifizierungen und Drittprüfungen helfen, Greenwashing zu vermeiden.
Wie Anbieter nachhaltiger werden können
— Investition in zusätzliche erneuerbare Energieprojekte (PPAs)
— Verbesserung der Energieeffizienz ihrer Rechenzentren
— Veröffentlichung verifizierter Emissionsdaten
— Förderung von Hardware-Recycling und längerer Lebensdauer
— Entwicklung energieeffizienter Cloud-Services (Serverless, nachhaltige Regionen-Auswahl)
Solche Maßnahmen sind keineswegs nur PR-Spielchen: Sie beeinflussen die langfristigen Betriebskosten, die Resilienz gegenüber Energiepreisvolatilität und das öffentliche Vertrauen.
Was kann ich als Nutzer tun?
Viele Menschen fühlen sich machtlos gegenüber großen Cloud-Anbietern — doch es gibt viele konkrete Hebel, die Nutzerinnen und Nutzer ziehen können. Ein nachhaltiger Umgang mit digitalen Diensten beginnt mit Bewusstsein: Brauche ich die fünf Cloud-Speicher-Backups? Muss ein Video in Full-HD oder reicht SD? Können automatische Backups komprimiert oder gelöscht werden? Diese Fragen klingen banal, aber multipliziert mit Millionen Nutzern haben sie Wirkung.
Für Unternehmen gibt es zusätzliche Handlungsfelder: Softwarearchitektur überdenken, Datensparsamkeit, Einsatz von Effizienz-Tools, Auswahl von Anbietern mit transparenten Nachhaltigkeitsberichten und sogar Vertragsklauseln, die den Einsatz erneuerbarer Energien fördern.
Liste 2: Praktische Tipps für private Nutzer und kleine Unternehmen
- Regelmäßig unnötige Dateien löschen und Archive auf lokale, energieeffiziente Medien auslagern.
- Cloud-Synchronisationen zeitlich planen (z. B. nachts, wenn Strommix günstiger und erneuerbarer ist).
- Fotos und Videos komprimieren; Auflösung nur so hoch wählen, wie nötig.
- Passwörter und Zugangsdaten gut verwalten, um Doppel-Accounts zu vermeiden.
- Bewusst Anbieter wählen: nach grünen Angeboten und transparenter CO2-Berichterstattung suchen.
Diese Tipps sind pragmatisch und schnell umzusetzen — und sie sparen oft auch Kosten. Digitalisierung muss nicht automatisch „mehr Verbrauch“ bedeuten; mit intelligenten Entscheidungen kann sie zu Effizienzgewinnen führen.
Politik, Regulierung und die Rolle der Gesellschaft
Politische Rahmenbedingungen lenken Investitionen. Subventionen, CO2-Preise, Netzausbau und Förderprogramme für erneuerbare Energien bestimmen, wie schnell Rechenzentren auf grüne Energie umsteigen können. Gesellschaftlicher Druck und Kundenforderungen spielen ebenfalls eine Rolle: Unternehmen, die Nachhaltigkeit ernst nehmen, stärken ihr Ansehen und minimieren langfristige Risiken.
Auf internationaler Ebene werden Standards und Reportingpflichten diskutiert, die digitale Dienste transparenter machen sollen. Nationale Infrastrukturentscheidungen, wie etwa die Standortwahl von Rechenzentren in Regionen mit ausreichender Stromkapazität, beeinflussen die ökologische Bilanz stark. Der Dialog zwischen Politik, Wirtschaft und Wissenschaft ist entscheidend, um praktikable Lösungen zu entwickeln.
Herausforderungen der Regulierung
— Unterschiedliche nationale Strommix-Realitäten erschweren einheitliche Regeln
— Balance zwischen Innovationsförderung und Regulierung finden
— Vermeidung von Standortverlagerungen in Regionen mit laxeren Standards
— Förderung von Kreislaufwirtschaft für Elektronik und Infrastruktur
Politische Maßnahmen sollten Anreize schaffen, echte Dekarbonisierung zu erreichen — nicht nur symbolische Maßnahmen belohnen.
Innovationen und Zukunftsaussichten
Die Zukunft der Cloud ist nicht zwangsläufig wenig nachhaltig; im Gegenteil: Technologische und organisatorische Innovationen können die Cloud deutlich grüner machen. Beispiele sind effizientere Prozessorarchitekturen, Edge-Computing zur Verringerung von Datenflüssen, KI-optimierte Workload-Steuerung und bessere Integration von Energiespeichern. Auch neue Geschäftsmodelle wie „Green SLAs“ (Service-Level-Agreements mit Nachhaltigkeitskriterien) könnten Standard werden.
Die Kombination aus besserer Hardware, intelligenterer Software und einem zunehmend grüneren Strommix bietet große Chancen. Für die kommenden Jahre sind zwei Entwicklungen besonders wichtig: Standardisierte Transparenz und die Integration von Energieaspekten in die gesamte Software- und Systementwicklung. Wer diese Chancen nutzt, kann nicht nur Emissionen senken, sondern auch wirtschaftlichen Vorteil erzielen.
Prominente technische Trends
— Spezialisierte Hardware (z. B. energieeffiziente Beschleuniger für KI)
— Edge Computing zur Reduzierung großer Datenströme
— Serverless-Modelle zur Minimierung von Overprovisioning
— KI-Optimierung für Energie- und Lastmanagement
— Kreislaufwirtschaftsmodelle für Hardware-Recycling und Upgrades
Diese Trends werden das Ökosystem verändern — und wer frühzeitig handelt, kann Vorreiter werden.
Fallstudien: Erfolgsgeschichten und Lernfelder
Einige große Anbieter haben bereits beachtliche Schritte gemacht: Investitionen in Wind- und Solarparks, Build-to-Suit-Rechenzentren mit niedrigen PUE-Werten oder Initiativen zur Abwärmenutzung. Andere Organisationen nutzen intelligente Softwareoptimierung, um den Energieverbrauch signifikant zu senken. Doch es gibt auch kritische Fälle: Rechenzentren, die trotz grüner PR einen hohen Anteil fossiler Energie nutzen, oder Anbieter, die ihre Emissionen unvollständig berichten.
Diese Fallstudien zeigen: Nachhaltigkeit ist ein Prozess, kein Zustand. Erfolge entstehen durch ein Bündel von Maßnahmen — Technik, Finanzierung, Kulturwandel und transparente Berichterstattung. Fehler passieren, aber sie bieten Lernmöglichkeiten, wenn Anbieter und Kunden offen darauf reagieren.
Tabelle 2: Vergleich ausgewählter Maßnahmen und ihrem typischen Impact auf den CO2-Fußabdruck
| Maßnahme | Typischer Impact | Skalierbarkeit |
|---|---|---|
| Direkter Bezug von Ökostrom / PPAs | Hoch (sofern zusätzlich) | Hoch |
| Verbesserung PUE durch Kühlung | Mittel | Mittel |
| Softwareoptimierung (Right-Sizing) | Mittel bis hoch | Hoch |
| Hardware-Recycling / längere Lebensdauer | Mittel | Mittel |
| Offsetting ohne zusätzliche Maßnahmen | Niedrig (nur temporär) | Hoch |
Ethik und soziale Aspekte

Digitale Nachhaltigkeit hat auch eine soziale Komponente: Zugriff auf Dateninfrastruktur, Arbeitsbedingungen in der Hardwareproduktion und die gerechte Verteilung von Vorteilen. Die Produktion von Chips und Servern findet oft in Ländern mit unterschiedlichem Arbeits- und Umweltstandard statt. Nachhaltigkeit bedeutet daher nicht nur CO2-Reduktion, sondern auch verantwortungsvolle Lieferketten und faire Arbeitsbedingungen.
Zudem stellt sich die Frage der digitalen Chancengleichheit: Wer profitiert von den Vorteilen grüner Cloud-Lösungen? Politische Maßnahmen sollten sicherstellen, dass Nachhaltigkeitsgewinne nicht nur wenigen großen Akteuren zugutekommen, sondern breite gesellschaftliche Vorteile schaffen — etwa durch Unterstützung von Bildung, Infrastruktur und lokalen Arbeitsplätzen.
Wichtigste soziale Themen
— Faire Arbeitsbedingungen in Lieferketten
— Zugänglichkeit und Gerechtigkeit beim Zugang zu nachhaltiger Infrastruktur
— Transparente Kommunikation gegenüber Kundinnen und Kunden
— Bildung und öffentliche Verantwortung
Diese Aspekte machen Nachhaltigkeit ganzheitlich und langfristig wirksam.
Schlussfolgerung
Digitale Nachhaltigkeit ist kein abstraktes Ideal, sondern ein praktischer Handlungsfeldmix aus Technik, Organisation, Politik und individuellem Verhalten. Die Cloud kann deutlich umweltfreundlicher werden — durch erneuerbare Energien, effizientere Rechenzentren, smarte Softwarearchitekturen und transparente Berichterstattung. Entscheidend ist, dass Anbieter, Nutzer und Politik zusammenarbeiten: Anbieter müssen klare, verifizierbare Maßnahmen ergreifen, Nutzer sollten bewusst konsumieren und optimieren, und die Politik muss Rahmenbedingungen setzen, die echte Dekarbonisierung belohnen. Das Ergebnis kann eine Cloud sein, die nicht nur leistungsfähig und zuverlässig ist, sondern auch verantwortungsvoll mit unserer Umwelt umgeht — eine digitale Wolke, die wirklich leicht und grün zugleich ist.