Bildhaft gesprochen sind Open Educational Resources (OER) wie ein großer, offener Marktplatz des Wissens: Menschen aus allen Teilen der Gesellschaft bringen mit, was sie gelernt haben, bearbeiten es weiter, geben es frei und holen sich dafür anderes Wissen zurück. Dieser Artikel nimmt Sie mit auf eine Reise durch die Welt der OER — was sie sind, warum sie wichtig sind, wie sie verwendet werden, welche rechtlichen Rahmenbedingungen gelten, welche Chancen und Herausforderungen es gibt und wie Lehrende, Lernende und Entscheidungsträger gemeinsam eine offene Bildungslandschaft stärken können. Unterhaltsam, praxisnah und reich an Beispielen — damit Sie nicht nur lesen, sondern anfangen, OER zu nutzen oder selber beizutragen.
Was sind OER?
Open Educational Resources, kurz OER, sind Lehr-, Lern- und Forschungsmaterialien, die frei zugänglich sind und unter Lizenzen stehen, die ihre Nutzung, Anpassung und Weitergabe erlauben. Das kann vieles sein: komplette Lehrbücher, Arbeitsblätter, Videos, Unterrichtssequenzen, Prüfungsfragen, Vorlesungsfolien, Simulationen oder kleine interaktive Anwendungen. Entscheidend ist nicht nur, dass die Materialien kostenlos herunterladbar sind, sondern dass sie ausdrücklich mit Bedingungen versehen sind, die das Teilen und Verändern erlauben.
OER entstehen oft in Netzwerken: Universitäten, Schulen, gemeinnützige Organisationen und engagierte Einzelpersonen erstellen Inhalte und stellen sie unter offenen Lizenzen zur Verfügung. Diese Materialien fördern kollaboratives Arbeiten und machen Bildung unabhängiger von teuren Lehrmitteln. Doch OER sind mehr als nur „kostenlos“ — sie sind ein kultureller Impuls für Partizipation, Transparenz und demokratische Bildung.
Viele Menschen denken bei OER zuerst an digitale Formate — und das ist naheliegend. Digitale Materialien lassen sich leicht kopieren, teilen und modifizieren. Dennoch können OER auch analoge Materialien sein, solange ihre Lizenzbedingungen offenes Teilen erlauben. Das Herzstück bleibt: Wissen, das nicht hinter Bezahlschranken oder engen Nutzungsrechten verborgen ist.
Warum OER wichtig sind
OER haben das Potenzial, Bildung inklusiver und gerechter zu machen. Sie senken die Kosten für Lernende, die sich sonst teure Lehrbücher, Lizenzen für Software oder Zugang zu bezahlten Inhalten leisten müssten. Für Bildungseinrichtungen bieten OER die Möglichkeit, Curricula flexibler zu gestalten und Materialien schnell an lokale Bedürfnisse anzupassen. In Ländern oder Regionen mit begrenztem Budget für Bildungsressourcen können OER einen enormen Unterschied machen.
Ein weiterer, vielleicht noch wichtigerer Punkt ist die pädagogische Freiheit: Lehrende können OER anpassen, ergänzen und kombinieren, um Lerninhalte besser auf die Zielgruppe zuzuschneidern. Das fördert innovative Lehrkonzepte, differenzierten Unterricht und die aktive Einbindung von Lernenden. OER ermöglichen auch peer-to-peer-Lernen, weil Lernende selbst Materialien erstellen, kommentieren und weitergeben können — ein Prozess, der Wissen vertieft und Verantwortungsbewusstsein stärkt.
Auf politischer Ebene fördern OER die Transparenz von Lehrinhalten und erleichtern die Zusammenarbeit zwischen Institutionen. Viele Regierungen unterstützen OER, weil sie eine kosteneffiziente Möglichkeit sind, Bildungsziele zu erreichen und Bildungsgerechtigkeit zu fördern. Unternehmen profitieren ebenfalls, etwa indem sie Mitarbeiterschulungen offen gestalten oder Inhalte zur Weiterbildung der Gesellschaft beitragen.
Die rechtliche Grundlage: Lizenzen verstehen
Ein zentraler Aspekt von OER ist das Lizenzierungsmodell. Ohne klare Lizenz ist ein Material nicht automatisch „offen“ — es braucht ausdrückliche Erlaubnis zur Nutzung, Modifikation und Weitergabe. Die bekanntesten Lizenzen stammen von Creative Commons (CC). Sie sind modular aufgebaut und erlauben eine Kombination bestimmter Bedingungen.
Die gebräuchlichsten Bedingungen sind:
— Namensnennung (BY): Der Urheber muss genannt werden.
— Nicht kommerziell (NC): Nutzung ist nur nicht kommerziell erlaubt.
— Keine Bearbeitung (ND): Das Werk darf nicht verändert werden.
— Weitergabe unter gleichen Bedingungen (SA): Bearbeitete Versionen müssen unter derselben Lizenz weitergegeben werden.
OER-Ziele sprechen in der Regel für Lizenzen mit BY und oft SA — also Namensnennung und Weitergabe unter gleichen Bedingungen — weil sie Anpassungen erlauben. Lizenzen mit ND oder NC schränken die Offenheit ein und sollten bewusst gewählt werden. Es ist essentiell, dass Lehrende und Institutionen die Lizenzbedingungen prüfen und korrekt angeben, damit Nutzer wissen, was erlaubt ist.
Gerade beim Mix aus verschiedenen Materialien (z. B. ein OER-Lehrbuch, das Bilder unter unterschiedlichen Lizenzen verwendet) müssen Lizenzkompatibilitäten beachtet werden. Eine Praxis, die sich etabliert hat, ist die klare Dokumentation von Quellen und Lizenzen innerhalb der Materialien selbst — das erleichtert künftige Nutzungen.
Qualität und Didaktik: Wie gut sind OER?
Ein häufiges Vorurteil lautet: „Kostenlos heißt schlecht.“ Bei OER trifft das nicht zu, aber Qualität ist tatsächlich eine Frage, die seriös beantwortet werden muss. OER können sowohl exzellent als auch durchschnittlich sein. Entscheidend sind Qualitätssicherung, Peer-Review, Nutzerfeedback und kontinuierliche Aktualisierung.
Viele OER-Plattformen arbeiten mit Peer-Reviews oder Nutzerbewertungen, die helfen, die Qualität einzuschätzen. Lehrende können und sollten Materialien vor der Nutzung prüfen und anpassen. Eine gute Praxis ist, OER in modulare Bestandteile zu zerlegen — kurze Lerneinheiten sind leichter bewertbar, austauschbar und anpassbar als ein starres Ganzes.
Didaktisch sollten OER mehrere Ebenen abdecken: klare Lernziele, abwechslungsreiche Aufgaben, formative Rückmeldungen und Möglichkeiten zur Selbstüberprüfung. Interaktive Elemente wie Quizze, Simulationen oder Diskussionsanregungen erhöhen die Lernwirksamkeit. Auch Zugänglichkeit (Barrierefreiheit) ist Teil der Qualität: Texte mit klaren Strukturen, alternative Formate für Bilder und Videos mit Untertiteln machen OER für mehr Menschen nutzbar.
Beschreibungstabelle: Qualitätskriterien für OER
| Nr. | Kriterium | Was zu prüfen ist | Warum wichtig |
|---|---|---|---|
| 1 | Korrektheit | Fachliche Richtigkeit prüfen | Verhindert Fehlwissen |
| 2 | Aktualität | Datum und Referenzen ansehen | Wissen bleibt relevant |
| 3 | Didaktische Struktur | Lernziele, Aufgaben, Feedback vorhanden? | Ermöglicht effektives Lernen |
| 4 | Zugänglichkeit | Alternative Texte, Untertitel, kontrastreicher Text | Inklusion sicherstellen |
| 5 | Lizenzklarheit | Welche Rechte sind erlaubt? | Vermeidet rechtliche Probleme |
| 6 | Nutzerfeedback | Bewertungen, Kommentare, Verbesserungen | Fördert kontinuierliche Verbesserung |
Technologie & Plattformen: Wo findet man OER?

OER leben im Netz — aber das Internet ist groß. Es gibt spezialisierte Plattformen, Repositorien, Universitätsseiten und Lehrportale. Bekannte internationale Plattformen sind OER Commons, MERLOT und die Materialien der Wikimedia-Projekte. Viele Hochschulen bieten eigene OER-Repositorien an, und nationale Bildungsportale sammeln Materialien für Schulen.
Neben Plattformen gibt es technische Formate: PDF und HTML sind die gängigsten, aber offene Formate wie EPUB oder ODT sind flexibler, weil sie leichter zu bearbeiten sind. Auch Learning-Management-Systeme (LMS) wie Moodle unterstützen OER durch einfache Einbindung und Bearbeitungsmöglichkeiten. Moderne OER setzen zunehmend auf offene Standards, damit Inhalte interoperabel sind und in verschiedenen Systemen weiterverarbeitet werden können.
Wichtig ist die Auffindbarkeit: Schlagwörter, Metadaten und klare Lizenzangaben machen Materialien leichter zugänglich. Suchmaschinenoptimierung und zentrale Repositorien helfen, dass gute OER nicht im Netz-Meer verschwinden.
Nummerierte Liste 1: Beliebte Plattformtypen für OER
- Universitäre Repositorien (z. B. Hochschul-Open-Access-Server)
- Fachspezifische Portale (z. B. für Mathematik, Fremdsprachen, Medizin)
- Community-basierte Sammlungen (z. B. OER Commons)
- Wikibasiertes Material (z. B. Wikimedia, WikiEducator)
- Plattformen öffentlicher Bildungsträger (z. B. Bundes- oder Landesbildungsportale)
- Verlage mit offenen Inhalten (hybride Modelle)
Praxis: Wie Lehrende OER im Unterricht einsetzen
Die Praxis zeigt: OER können auf vielfältige Weise eingesetzt werden. Als Ersatz für teure Lehrbücher, als Ergänzung zu bestehenden Materialien, als Grundlage für Projektarbeiten oder als Inspirationsquelle für neue Unterrichtseinheiten. Ein Lehrender könnte etwa ein offenes Kapitel eines Lehrbuchs verwenden, dazu eigene Aufgaben erstellen und die Inhalte in einer lokalen Lernplattform mit den Lernenden teilen.
OER ermöglichen auch Flipped Classroom-Modelle: Videos und Lektüren werden vor der Sitzung angeschaut, in der Präsenzphase wird zusammen gearbeitet, diskutiert und geübt. Lernende profitieren davon, weil sie Inhalte in ihrem Tempo bearbeiten können. Außerdem sind OER ideal für Differenzierung: Zusätzliche Materialien für schnellere Lernende oder unterstützende Erklärungen für solche, die mehr Hilfe brauchen.
Eine praktische Empfehlung: Beginnen Sie mit einem kleinen, überschaubaren Projekt — etwa einer einzelnen Lerneinheit oder einer Sammlung von Arbeitsblättern. Probieren Sie verschiedene Materialien aus, sammeln Feedback und dokumentieren Sie, welche Anpassungen Sie vorgenommen haben. Dieser iterative Ansatz reduziert den Aufwand und erhöht gleichzeitig die Wirkung.
Nummerierte Liste 2: Schritte zur Integration von OER in den Unterricht
- Ziele festlegen: Welche Lernziele sollen erreicht werden?
- Materialsuche: Repositorien durchsuchen und passende OER finden
- Lizenzprüfung: Erlaubt die Lizenz die gewünschte Nutzung?
- Anpassung: Materialien lokal anpassen und didaktisch ergänzen
- Testen: Mit einer kleinen Lerngruppe ausprobieren
- Feedback einholen: Einstellungen der Lernenden aufnehmen und Materialien überarbeiten
- Teilen: Eigene Versionen wieder als OER veröffentlichen
Beispiele: Inspirierende OER-Projekte
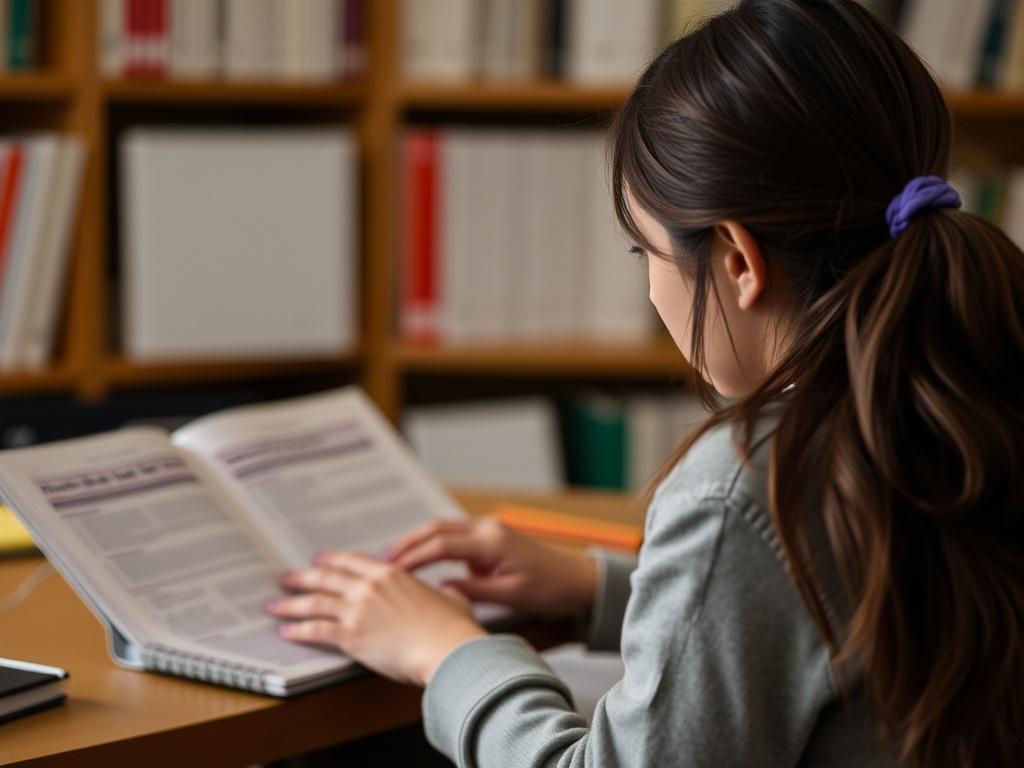
Es gibt viele erfolgreiche OER-Initiativen weltweit, die zeigen, wie vielfältig der Bereich ist. Einige Beispiele illustrieren unterschiedliche Herangehensweisen: Massive Open Online Courses (MOOCs) mit offenen Materialien, Open Textbooks, die ganze Lehrbuchkapitel ersetzen, und lokale Community-Projekte, die kulturelle Inhalte erarbeiten und zugänglich machen.
Ein Beispiel aus der Schulbildung sind offene Arbeitshefte, die von Lehrkräften eines Bundeslands gemeinsam entwickelt werden. In der Hochschulbildung überzeugen Projekte wie offene Einführungstexte in Mathematik oder Programmierung, die von Professorinnen und Professoren in Zusammenarbeit mit Studierenden erstellt werden. Solche Projekte sparen Kosten, fördern Innovation und entwickeln sich oft organisch weiter, weil Nutzer Verbesserungen beitragen.
Auch nicht-akademische Initiativen sind wichtig: NGOs, die Erwachsenenbildung unterstützen, stellen einfache Lernmaterialien für Sprachen, Finanzwissen oder Gesundheit bereit. In Krisengebieten sind OER oft lebenswichtig, weil sie Bildung auch ohne teure Infrastruktur ermöglichen.
Vorteile für Lehrende, Lernende und Institutionen
Die Vorteile sind vielfältig und betreffen verschiedene Akteure:
— Lehrende gewinnen Freiheit bei der Gestaltung von Kursinhalten, können Didaktik personalisieren und die eigene Arbeit sichtbarer machen.
— Lernende profitieren von niedrigeren Kosten, mehr Vielfalt an Lernmaterialien und Möglichkeiten zur aktiven Mitgestaltung.
— Institutionen sparen Ressourcen, fördern Innovation und stärken ihren Bildungsauftrag.
Ein oft unterschätzter Vorteil ist die Professionalisierung durch Beteiligung an OER-Projekten. Lehrende, die Materialien erstellen und veröffentlichen, reflektieren ihre Lehre und dokumentieren ihre Arbeit — das kann in der Lehrevaluation und Karriereförderung positiv wirken.
Herausforderungen und mögliche Lösungen
OER sind kein Wundermittel und stehen vor realen Herausforderungen. Dazu gehören Finanzierung, Zeitaufwand für Erstellung und Pflege, rechtliche Unsicherheiten, Qualitätskontrolle und mangelnde Sichtbarkeit. Doch viele dieser Hürden sind lösbar.
Finanzierung lässt sich über öffentliche Mittel, Förderprogramme, institutionelle Budgets oder hybride Geschäftsmodelle sichern (z. B. Druckkosten für Open Textbooks, bezahlte Zusatzservices). Zeitaufwand kann durch kollaborative Erstellung und die Wiederverwendung vorhandener Materialien reduziert werden. Rechtliche Unsicherheiten lassen sich durch klare Schulungen und Vorlagen für Lizenzhinweise minimieren.
Für Qualitätsfragen helfen Peer-Review-Mechanismen, Nutzerbewertungen und modularer Aufbau. Sichtbarkeit erhöht man durch Metadaten, Kooperationen zwischen Institutionen und aktive Verbreitung. Offenheit lebt von Gemeinschaft — je stärker Netzwerke, desto besser die Lösungen.
Beschreibungstabelle: Herausforderungen und Gegenmaßnahmen
| Herausforderung | Konkretes Problem | Gegenmaßnahme |
|---|---|---|
| Finanzierung | Erstellung und Pflege kosten Zeit und Geld | Fördermittel, institutionelle Budgets, Crowdfunding |
| Qualitätssicherung | Unterschiedliche fachliche Qualität | Peer-Review, Nutzerbewertungen, professionelle Redaktion |
| Rechtliche Fragen | Unsicherheit bei Lizenzen | Schulungen, Lizenzvorlagen, rechtliche Unterstützung |
| Sichtbarkeit | Gute Materialien bleiben unentdeckt | Metadaten, zentrale Repositorien, Netzwerke |
| Technische Barrieren | Kompatibilität, Zugänglichkeit | Offene Formate, Standards, Barrierefreiheit |
Politik, Strategie und Finanzierung: Wer unterstützt OER?
Viele Staaten und Bildungsinstitutionen haben OER in ihre Strategien aufgenommen. Städtische, regionale und nationale Förderprogramme unterstützen die Erstellung und Verbreitung offener Lernmaterialien. Die politische Unterstützung ist sinnvoll, weil Bildung ein öffentliches Gut ist und OER zur Erreichung gesellschaftlicher Ziele beitragen.
Finanzierungsmodelle sind vielfältig: öffentliche Mittel, Stiftungsförderung, projektbezogene Gelder, institutionelle Budgets oder Mischformen. Einige Verlage bieten hybride Modelle an, bei denen grundlegende Inhalte offen sind, ergänzende Services (z. B. individuelle Lernpfade, Tutorien) jedoch bezahlt werden. Solche Modelle können die Nachhaltigkeit sichern, bergen aber die Gefahr, die Offenheit zu verwässern — eine Balance ist gefragt.
Strategisch ist wichtig, OER nicht als isoliertes Projekt, sondern als Teil einer Bildungsstrategie zu denken. Das bedeutet Investitionen in Infrastruktur, Fortbildungen für Lehrende, Unterstützung bei rechtlichen Fragen und die Schaffung von Anreizen zur Erstellung von OER (z. B. Anerkennung in Karrierepfaden).
Wie man selbst OER erstellt — praktisch und pragmatisch
Eigene OER zu erstellen ist leichter als viele denken. Der Schlüssel liegt in gutem Projektmanagement, klaren Lizenzen und modularer Produktion. Beginnen Sie klein: Ein kurzes Modul, ein Arbeitsblatt oder ein Erklärvideo sind ideale Einstiege. Nutzen Sie offene Tools (z. B. LibreOffice, Audacity, OBS Studio) und speichern Sie in offenen Formaten.
Dokumentieren Sie Quellen und Lizenzen sorgfältig. Fügen Sie ein Lizenzkürzel und eine kurze Erklärung an den Anfang Ihres Materials. Bauen Sie Metadaten ein (Autor, Institution, Datum, Lernziele, Zielgruppe), damit andere das Material leichter finden und nutzen können. Bitten Sie Kolleginnen und Kollegen um Feedback und stellen Sie später die überarbeitete Version als OER zur Verfügung.
Kooperation lohnt sich: Arbeiten Sie mit Fachkollegium, Studierenden oder anderen Schulen zusammen. So teilen Sie die Arbeit, erhöhen die Qualität und schaffen eine Community, die Materialien dauerhaft pflegt.
Nummerierte Liste 3: Checkliste zur Erstellung von OER
- Idee und Zielgruppe definieren
- Bestehendes Material recherchieren
- Lizenzen überprüfen und wählen
- Material erstellen (Text, Bild, Video, interaktive Elemente)
- Metadaten und Lizenzhinweis hinzufügen
- Peer-Feedback einholen und überarbeiten
- Material veröffentlichen und verbreiten
- Regelmäßig aktualisieren
OER und die Kultur des Teilens: Ein soziales Projekt
OER sind nicht nur technische oder rechtliche Objekte — sie sind Ausdruck einer Kultur des Teilens. Diese Kultur beruht auf Vertrauen, Anerkennung und dem Wunsch, Bildung zu demokratisieren. Wenn Lehrende Materialien teilen, entsteht gegenseitige Wertschätzung und eine Wissensökonomie, die nicht ausschließlich von Marktmechanismen bestimmt wird.
Gleichzeitig braucht eine solche Kultur institutionelle Unterstützung: Anerkennung für erstellte OER in Leistungskatalogen, Zeitfenster für Mitarbeit an offenen Materialien und Möglichkeiten zur Weiterbildung. Wenn das Teilen honoriert wird, wächst die Bereitschaft, Qualitätsmaterialien zu schaffen.
Die Kultur des Teilens wirkt sich auch auf Lernende aus: Wer in offenen Projekten mitarbeitet, lernt Teamarbeit, Medienkompetenz und Eigenverantwortung. Das sind Kompetenzen, die in der digitalen Gesellschaft immer wichtiger werden.
Zukunftsperspektiven: Wohin geht die Reise?

Die OER-Bewegung steckt voller Potenzial. Technologische Entwicklungen wie KI, adaptive Lernsysteme und verbesserte Autorenwerkzeuge werden OER noch zugänglicher und interaktiver machen. KI kann helfen, Inhalte automatisch zu aktualisieren, Zusammenfassungen zu generieren oder personalisierte Lernpfade vorzuschlagen — vorausgesetzt, die verwendeten Daten und Lizenzen sind kompatibel.
Ein weiterer Trend sind offene Bildungsökosysteme: Vernetzte Plattformen, standardisierte Metadaten und APIs, die Materialien über Systeme hinweg nutzbar machen. Solche Ökosysteme erleichtern das Finden, Zusammenstellen und Wiederverwenden von OER.
Politisch ist zu erwarten, dass mehr Staaten OER in Bildungsstrategien aufnehmen und langfristige Förderstrukturen schaffen. Gleichzeitig müssen Fragen nach Nachhaltigkeit, Finanzierung und Qualitätskontrolle weiterentwickelt werden.
Kurz: Die Reise ist noch lange nicht zu Ende. Wer heute OER nutzt oder mitgestaltet, legt einen wichtigen Baustein für eine offene Bildungszukunft.
Praktischer Tipp: Kleine Experimente mit großer Wirkung
Sie müssen nicht gleich ein ganzes Lehrbuch veröffentlichen. Beginnen Sie mit kleinen Experimenten: Stellen Sie ein einzelnes Kapitel oder ein Arbeitsblatt unter einer CC-BY-Lizenz online. Fragen Sie Lernende, ob sie Verbesserungsvorschläge haben, und veröffentlichen Sie eine zweite Version. Solche kleinen Schritte führen schnell zu sichtbaren Ergebnissen und motivieren zur weiteren Arbeit.
Ein weiterer Tipp: Vernetzen Sie sich. E-Mail-Listen, lokale OER-Gruppen und Online-Communities sind wertvolle Quellen für Feedback, Kooperation und Motivation.
Schlussfolgerung
Open Educational Resources sind mehr als nur kostenlose Materialien: sie sind ein Wandel in der Art, wie wir Wissen produzieren, teilen und nutzen. OER ermöglichen gerechteren Zugang, fördern pädagogische Innovation und stärken die Zusammenarbeit zwischen Lernenden, Lehrenden und Institutionen. Herausforderungen wie Finanzierung, Qualitätssicherung und rechtliche Klarheit sind real, aber lösbar — durch Kooperation, klare Strategien und mutige Experimente. Wenn mehr Menschen Materialien offen teilen und aktiv an ihrer Weiterentwicklung mitarbeiten, entsteht eine Bildungslandschaft, die flexibler, nachhaltiger und inklusiver ist. Starten Sie klein, denken Sie kollaborativ und gestalten Sie Bildung mit — OER sind eine Einladung, kein abgeschlossenes Projekt.